 |
 |
 |
 |
 |
 |
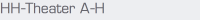 |
 |
 |
Allee Theater/Theater für Kinder
Alma Hoppe
Altes Heizkraftwerk
Altonale
Altonaer Theater
Die Burg
Elfen im Park
Elbphilharmonie
Engelbach&Weinand
Engelsaal
English Theatre
Ernst Deutsch Theater
Fabrik
Feine Künste
Fleetstreet
First Stage
Gilla Cremer Unikate
Hamburger Puppentheater
Hamburger Sprechwerk
Hamburgische Staatsoper/Opera stabile
Hebebühne
Hochschule für Musik und Theater
Hüter-Ensemble
Fluctoplasma
|
 |
 |
 |
 |
 |
Imperial Theater
Kammerspiele, Logensaal
Kampnagel
Kellertheater
Klabauter Theater
Kulturhaus 73
Kraftwerk Bille
Lichthof
Meyer&Kowski
Monsun Theater
MS Bleichen, MS Stubnitz
MUT-Theater
Opernloft
Operettenhaus
Ohnsorg Theater
Polittbüro
Resonanzraum
Schauspielhaus
Schauspielstudio Frese
Savoy
Das Schiff
Schmidt Theater
Schmidts Tivoli
Sommertheater St. Georg
St. Pauli Theater
|
 |
 |
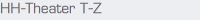 |
 |
 |
Thalia Theater
Theater Altes Heizkraftwerk
Theater Axensprung
Theater Das Zimmer
Theaterdeck
Theater im Hamburger Hafen
Theater im Zimmer
Theater in der Speicherstadt
Theater Kehrwieder
Theater N.N.
Theater Zeppelin
Tonali
University Players
Werkstatt 3
Winterhuder Fährhaus, Theater Kontraste
Die 2te Heimat
U3-Ensemble
Die Wiese
|
 |
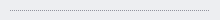 |
 |
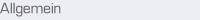 |
 |
 |
Startseite
Bernarda Albas Haus, Schauspielhaus
Slow burn, Hamburg Ballett
Finale Furioso, Monsun
Spiegelneuronen, Kampnagel
KEIN SCHÖNER SCHLAND, Hf MT
IM CABARET, AU CABARET, TO CABARET, HfMT
Eigengrau, Sprechwerk
Der alte Mann und ein Meer, HfMT
Zu Schad, Tonali
A PLACE CALLED HOME, Kampnagel
Ocean cage, Kampnagel
Der eigene Tod, DSH
Gesetze schreddern, Malersaal
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
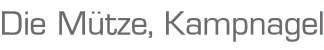 |
I walk alone |
 |
|
Zwei Menschen laufen durch den Wald, hintereinander, scheinbar ohne sich zu beachten, mit sich selbst beschäftigt. Ihr Wald besteht aus lauter Baumstämmen (Bühnenbild: Jan-Carl Fischer), die von der Decke hängen, an Fleischerhaken aufgehängt und schräg auf den Boden aufstupsend. Zuerst laufen sie auf ihrem jeweiligen Laufband jeder für sich alleine, ganz passend zum Song "I walk alone", doch dann versuchen sie Kontakt aufzunehmen, den anderen in der Akrobatik und dem Einfallsreichtum ihrer Schritte zu übertrumpfen, bis ihr Elan wieder erlahmt und nur noch einer von ihnen übrig bleibt. Bis allerdings jemand von ihnen zu sprechen beginnt, gibt erstmal der Wald Töne von sich. Dazu schlägt der Musiker Philipp Krebs mit einem Hammer auf die Baumstämme und ihre unterschiedlichen Klänge hallen lange im Loop nach. Geheimnisvoll und andeutungsreich ist dieser stimmungsvolle Beginn.
Dann wird es finster. Denn genau dieser furchteinflößende Übergang von der Dämmerung in die absolute Dunkelheit ist die Bedrohung, die den Protagonisten in diese Waldeinsamkeit geführt hat. Er, der seine Seele als krankhaftig beschreibt und sich nahe vor dem Verrücktwerden sieht, das er einerseits herbeisehnt und fürchtet, will sich diesen Bewährungsproben stellen. Hält er diese Finsternis nach Hereinbrechen der Dunkelheit aus, so kann er sich weiteren Herausforderungen stellen. Vielleicht jedenfalls. Doch regelmäßig beim Schwinden des Lichts flieht er aus dem Haus und wendet sich der Straße zu, die in eines der beiden Dörfer führt. Auf einem dieser Wege findet er eine Mütze und fortan haben seine kreisenden Gedanken einen Fokus gefunden, nämlich diese Mütze. Obwohl er in der eisigen Kälte des Winters eine solche Mütze gut gebrauchen könnte, empfindet er sofort, dass er kein Recht auf so eine Mütze hat. Steht sie doch Arbeitern wie den Schlachtern, Bauern oder Forstarbeitern zu. Er ist also verpflichtet diese Mütze zurückzugeben. Ab jetzt sprechen die Bäume nicht mehr zu ihm sondern nur die Mütze. Sie fordert ihn auf, ihren rechtmäßigen Besitzer ausfindig machen. Obwohl er an allen Türen brüsk abgewiesen wird, führt er beharrlich seine Suche fort. Er, der die Einsamkeit suchte, muss sich jetzt dem unerwünschten Gespräch mit völlig fremden Leuten stellen, die ihm alle die Tür vor der Nase zuschlagen. Als er nach dieser erfolglosen Odyssee wieder zurück in sein Waldhaus zurückkommt, ist er völlig erschlagen. Um sich zu fangen, fängt er zu schreiben. Ihm wird kalt. Er streift sich unwillkürlich die wärmende Mütze über. Alle haben so eine Mütze, hatte er festgestellt. Jetzt hat er auch eine. Die Baumstämme, die ihn dicht umgeben hatten, schwinden langsam in die Höhe und baumeln nun nur noch hoch oben drohend über ihm, nicht mehr erreichbar und scheinbar doch stets kurz vor der Möglichkeit herunterzustürzen. Warum stürzt eine Mütze diesen Mann in eine solche Verwirrung? Er sucht in seiner verwirrten Kopfwelt die Ordnung und findet sie nicht. Eine Mütze gehört auf den Kopf eines Arbeiters und nicht auf seinen. Indem er sie nicht zurückgeben kann, stürzt er ins scheinbar Bodenlose.
Jungregisseur Simon Hastreiter gelingen in seiner Abschlussinszenierung durch das äußerst gelungene Bühnenbild viele interessante beziehungsreiche Bilder. Als die eine Darstellerin des Protagonisten Pauline Gloger (besonders beeindruckend) durch die Baumstammreihen läuft, sie anstößt, diese wild zu tanzen beginnen und Gloger dennoch wie ein gehetzter Hase durch die Reihen läuft, bekommt man ein Gefühl für die Verfolgung durch die sich jagenden Gedanken im Kopf des Protagonisten. Wenn der zweite Darsteller Max Kurth auf einen schwingenden Baumstamm springt und sich die Bedrohung umklammernd daran festhält, zeigt das die Symbiose zwischen Abhängigkeit, Befürchtung und Faszination kurz vor dem Absturz. Die dialogische Auflösung des Textes auf zwei Personen erlaubt weitere Dimensionen der inneren Auseinandersetzung. Die innovative Klangerzeugung mit Hilfe der Baumstämme ist beeindruckend. Umso mehr bedauert man das äußerst abrupte, überraschende, frühe Ende. Man hätte noch gerne weiter den möglichen atmosphärischen Bildern und Tönen nachgespürt, die hier ein verwirrter Kopf, ein Wald und eine Mütze ausgelöst haben. Sicher beabsichtigt, denn warum sollte bei einem solchen Text von Thomas Bernhard über die erfolglose Suche nach Struktur etwas anderes als eine Reihe von schwankenden Fragezeichen am Ende stehen bleiben?
Birgit Schmalmack vom 24.1.22
|
 |

Doghnuts, Thalia Foto: Fabian Hammerl
|
|
Druckbare Version
|
|
Nordwind-Festival, Kampnagel
Dance Me!, Kampnagel
|
|
 |
|