 |
 |
 |
 |
 |
 |
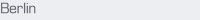 |
 |
 |
Berlin-Herbst-Special 2024
Berlin-Frühjahr-Special 2024
Berlin-Frühjahr-Special 2022
berlintheater 20/21
Berlin-Sommer-Special 2019
Berlin-Herbst-Special 2018
Berlin-Sommer-Special 2018
Berlin-Herbst-Special 2017
Berlin-Sommer-Special 2017
Berlin-Frühjahr-Special 2017
Berlin-Herbst-Special 2016
Berlin-Frühjahr-Special 2016
Berlin-Herbst-Special 2015
Berlin-Sommer-Special 2015
Berlin-Frühjahr-Special 2015
Berlin-Herbst-Special 2014
Berlin-Sommer-Special 2014
Berlin-Herbst-Special 2013
Berlin-Sommer-Special 2013
Berlin-Frühjahr-Special 2013
Berlin-Frühjahr-Special 2012
Berlin-Sommer-Special 2012
Berlin-Herbst-Special 2011
|
 |
 |
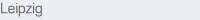 |
 |
 |
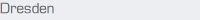 |
 |
 |
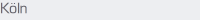 |
 |
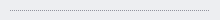 |
 |
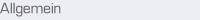 |
 |
 |
Startseite
Spiegelneuronen, Kampnagel
KEIN SCHÖNER SCHLAND, Hf MT
IM CABARET, AU CABARET, TO CABARET, HfMT
Eigengrau, Sprechwerk
Der alte Mann und ein Meer, HfMT
Zu Schad, Tonali
A PLACE CALLED HOME, Kampnagel
Ocean cage, Kampnagel
Der eigene Tod, DSH
Gesetze schreddern, Malersaal
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Diese Mischpoke |
 |
|
„Jiddisch für zusammengerotteter Haufen, der Probleme aus sich selbst heraus produziert und das als Lebensgrundlage braucht. Auch bekannt als FAMILIE“, so erklärt Rahel (Alexandra Sinelnikova) ihrer Mutter das Wort Mischpoke, und meint damit eigentlich ihre Beziehung zu ihrer eigenen Familie. Ihr Zwillings-Bruder ist schon geflohen aus der engen Umklammerung der familiären Bande in Berlin. Ausgerechnet nach Israel in einen Kibbuz. Rahel plant nun auch ihren Auszug. Sie will nach New York. Ihre Oma ersinnt sofort neidvoll eine spannende Zukunft für ihre Enkelin. Die große jüdische Community in New York soll möglich machen, was der früher gefeierten Bühnenkünstlerin verwehrt blieb.
Oma (Ursula Werner) war überzeugte Kommunistin, die nach dem Krieg mit voller Ideale in die DDR eingewandert ist und in der SED mitgekämpft hat. Wer in einem Land voller Widerstandskämpfer lebt, braucht sich nicht mit der geschichtlichen Vergangenheit des Nazi-Deutschland auseinander zu setzen, so glaubte sie. Bis auch sie und ihre Familie den Antisemitismus in der Einparteiendiktatur zu spüren bekam. Ihre Tochter (Anastasia Gubareva) konnte mit dem selbstgerechten Idealismus ihrer Mutter nichts anfangen, verschwand ins lebenslustige Paris um zu „studieren“ und kam schwanger zurück. Die Enkelin überlegt nun, wo sie hingehören könnte.
Marianne Salzmann hat ein hochverdichtetes Dialogstück über die verwickelten Abhängigkeiten und schwierigen Abnabelungsprozesse, die Verletzungen und die Verstrickungen innerhalb einer Familie geschrieben. Da sie es in einer deutsch-jüdischen Familie zwischen den Religionen, Kulturen, Ländern und Sprachen ansiedelt, wird die Identitätssuche weiter aufgeladen. Die Auseinandersetzungen zwischen den drei Frauengenerationen werden auf Augenhöhe und in aller Offenheit ausgetragen. Die Wortgefechte, die die Drei sich liefern, zielen und treffen genau, denn sie kennen sich gut.
Die Neuinszenierung des Stückes auf der großen Bühne des Gorki über zehn Jahre nach seiner Erstaufführung hat ihm nichts an seiner Pointiertheit und Aktualität genommen. Ganz im Gegenteil: Wenn heute von einem Überfall auf Israel an John-Kippur gesprochen wird, wenn der Umgang mit Antisemitismus in dem antifaschistischen Staatssystem der DDR und dem Schweigen in der Familie über die eigenen Verstrickungen in den Systemen thematisiert wird, scheinen die Fragen noch dringlicher geworden zu sein.
Dass Regisseur Hakan Savaş Mican Werner in Filmeinspielern auf der Bühnenleinwand in einem „History“-Format des RBB zeigt, wie sie souverän, selbstbewusst und dezent selbstkritisch ihre Erfahrungen als Künstlerin, Jüdin und Kommunistin in der DDR beschreibt, gibt das ihrer Rolle als Großmutter in der explosiven Dreierkonstellation der Familie noch einmal eine weitere Ebene. So abgeklärt kann man auch auf die gerade erlebte Gegenwart als Geschichte blicken. Weiterer Zündstoff für die Streitpunkte zwischen den drei Frauen.
Micanist eine wunderbar konzentrierte, fein gearbeitete, psychologisch genaue Inszenierung des zu Recht prämierten Textes gelungen. Das liegt nicht zuletzt an den drei hervorragenden Darstellerinnen. Besonders die distinguierte Haltung von Werner, die mit einer kleinen Kopfbewegung oder mit einer winzigen Änderung der Mimik so viel ausdrücken kann, beeindruckt. Doch auch Sinelnikovamacht als Tochter, die für ihren eigenen Weg zwischen den Fronten kämpft, ihre Positionen mit minimalen Mitteln nachfühlbar. Und Gubarevagibt Mican als zunächst noch in jeder Hinsicht biedere Mutter in lila Twinset mit Perlenkette ihren überraschenden Ausbruchsmoment, als sie mit ihrem Song „He baby, it’s a wild world“ ihre Perücke abwirft, ihre Haare freischüttelt, ihren Job kündigt und ihrem Freund den Laufpass gibt. Die Idee, den wunderbaren Musiker und Erzähler Daniel Kahn am Klavier zu platzieren und immer wieder jiddische Lieder und jüdische Witze mit einstreuen zu lassen, ist nicht nur eine gute Entscheidung in Sachen Atmosphäre sondern auch um die Unterschiede in Kultur, Sprache und Humor ganz direkt zu erleben. Manchmal kommt dann der Lacher etwas später. So wie der Oma, die mit einem trockenen „Haha“ kurz aufwacht, nachdem sie schon gestorben ist.
Birgit Schmalmack vom 24.10.24
|
 |

Muttersprache Mameloschn, Gorki © Ute Langkafel MAIFOTO
|
|
Druckbare Version
|
|
Missy Macabre, Grüner Salon
Pop, Pein, Paragraphen, Gorki
|
|
 |
|