 |
 |
 |
 |
 |
 |
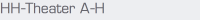 |
 |
 |
Allee Theater/Theater für Kinder
Alma Hoppe
Altes Heizkraftwerk
Altonale
Altonaer Theater
Die Burg
Elfen im Park
Elbphilharmonie
Engelbach&Weinand
Engelsaal
English Theatre
Ernst Deutsch Theater
Fabrik
Feine Künste
Fleetstreet
First Stage
Gilla Cremer Unikate
Hamburger Puppentheater
Hamburger Sprechwerk
Hamburgische Staatsoper/Opera stabile
Hebebühne
Hochschule für Musik und Theater
Hüter-Ensemble
Fluctoplasma
|
 |
 |
 |
 |
 |
Imperial Theater
Kammerspiele, Logensaal
Kampnagel
Kellertheater
Klabauter Theater
Kulturhaus 73
Kraftwerk Bille
Lichthof
Meyer&Kowski
Monsun Theater
MS Bleichen, MS Stubnitz
MUT-Theater
Opernloft
Operettenhaus
Ohnsorg Theater
Polittbüro
Resonanzraum
Schauspielhaus
Schauspielstudio Frese
Savoy
Das Schiff
Schmidt Theater
Schmidts Tivoli
Sommertheater St. Georg
St. Pauli Theater
|
 |
 |
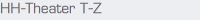 |
 |
 |
Thalia Theater
Theater Altes Heizkraftwerk
Theater Axensprung
Theater Das Zimmer
Theaterdeck
Theater im Hamburger Hafen
Theater im Zimmer
Theater in der Speicherstadt
Theater Kehrwieder
Theater N.N.
Theater Zeppelin
Tonali
University Players
Werkstatt 3
Winterhuder Fährhaus, Theater Kontraste
Die 2te Heimat
U3-Ensemble
Die Wiese
|
 |
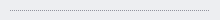 |
 |
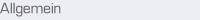 |
 |
 |
Startseite
Spiegelneuronen, Kampnagel
KEIN SCHÖNER SCHLAND, Hf MT
IM CABARET, AU CABARET, TO CABARET, HfMT
Eigengrau, Sprechwerk
Der alte Mann und ein Meer, HfMT
Zu Schad, Tonali
A PLACE CALLED HOME, Kampnagel
Ocean cage, Kampnagel
Der eigene Tod, DSH
Gesetze schreddern, Malersaal
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
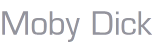 |
Moby Dick, Thalia |
 |
|
|
 |
 |
Moby Dick |
 |
|
Der Tod ist nur der Anfang der Reise
Kein Schiff, kein Wal, keine Takelage, kein Himmel ist auf der Bühne zu sehen. Nur acht Männer in schwarzer Kleidung auf schwarzer Bühne. Und dennoch wird der Zuschauer bald ein Schiff, einen Wal und das Meer zu sehen glauben. „Ich denke, die Welle kommt“, sagt einer. Doch still bleibt es. Stattdessen berichten sie alle einer nach dem anderen von ihrem von ihren Lebensängsten, die sie raus aufs Wasser treiben. Diese Männer werden eins. Sie werden zu einem Männerbund, der sich verbündet hat, um gegen die Leere und Sinnlosigkeit zu kämpfen. Wie ein Mann stehen sie in Achtererformation am Bühnenrand und sprechen mit einer Stimme. In Ermangelung eines anderen Lebensinhaltes werden sie alle zu Käpt’n Ahab, der sich nur noch einem Ziel verpflichtet fühlt: Er will den Weißen Wal „Moby Dick“ erlegen.
Doch schon zu Beginn ist klar: Diese Männer suchen mehr als Moby Dick. Sie suchen nach einem Sinn, nach einem Ziel, nach einer Erfüllung in ihrem sonst so ereignislosen Leben. „Das Grauen ruht in uns.“ Moby Dick wird zu dem personifizierten Bösen, das sie in sich zu vernichten suchen.
Doch zunächst bekommen sie Arbeit bis zur totalen Erschöpfung. Und diese macht Regisseur Romero Nunes fühlbar. Kaum ist der eine Wal erlegt und zerlegt, das Schiff wieder gesäubert, wird der nächste Wal gesichtet und die Arbeit geht von vorne los. Nunes braucht nicht viel, um die kräftezehrende und blutspritzende Tätigkeit zu zeigen. Mit Wasser gefüllte Spritzflaschen zeigen das blasende Luftrohr des nahenden Wales an. Mit blutroter Flüssigkeit gefüllte Flaschen werden als schneidende Messer zum Zerlegen des Wales benutzt. Bald ist die Bühne mit Wassermassen und Kunstblut zu einem rutschigen, nassen, dreckigen und gefährlichen Areal geworden. Wenn Wind- und Nebelmaschinen hinzukommen, ist der Sturm greifbar nahe, der das Walfängerschiff umzuwerfen droht. Das massenweise Abschlachten der Wale bringt neben der Erschöpfung auch die Sinnfrage aufs Neue auf die Agenda: Ist das nicht auch Menschenmord, fragt einer von ihnen. Nein, das ist das Menschenleben, antwortet ein anderer sogleich.
Monologe einzelner grandioser Schauspieler werden zu Höhepunkten des Abends. Wenn Mirco Kreibich über die „Weiße“ philosophiert, Daniel Lommatsch über Fest- und Losfisch oder Jörg Pohl über die Physiognomie und Anatomie des Wales referiert, ist das an Tiefsinn, Hintergründigkeit und Witz nicht zu überbieten und jeder hört gebannt zu.
Ästhetisch ist die Aufführung nicht nur wegen der Bühneneinfälle. Streckenweise fühlt man sich in die Choreographie eines Männerballetts versetzt. Da die völlig durchnässten und verdreckten Männer sich immer wieder auf offener Bühne säubern und umziehen müssen, bekommt man viele gut gebaute Männeroberkörper zu sehen. Auch die homoerotischen Momente einer Männergemeinschaft spart Nunes nicht aus.
Moby Dick werden sie folglich in dieser Inszenierung nicht treffen. Erst ganz zum Schluss lässt eine riesige Fontäne mitten zwischen vermuten, dass der Wal sich jetzt auf den Kampf, den nur er gewinnen kann, einlässt. Doch da sind die acht Walfänger schon in der internationalen Seefahrermasse auf der Bühne aufgegangen, die ihre vergangenen oder zukünftigen Fahrten mit Reden, singen und Tanzen feiert und doch nur dem sicheren Untergang geweiht ist. Dieser Seitenhieb auf die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen der heutigen Seefahrt wird dann aber auch der einzige gesellschaftskritische Moment in der Aufsehen erregenden und actionreichen Inszenierung von Nunes bleiben.
Birgit Schmalmack vom 23.10.13
|
 |
 |
|
Druckbare Version
|
|
Rum & Wodka
Geschichten aus dem Wiener Wald
|
|
 |
|