 |
 |
 |
 |
 |
 |
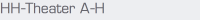 |
 |
 |
Allee Theater/Theater für Kinder
Alma Hoppe
Altes Heizkraftwerk
Altonale
Altonaer Theater
Die Burg
Elfen im Park
Elbphilharmonie
Engelbach&Weinand
Engelsaal
English Theatre
Ernst Deutsch Theater
Fabrik
Feine Künste
Fleetstreet
First Stage
Gilla Cremer Unikate
Hamburger Puppentheater
Hamburger Sprechwerk
Hamburgische Staatsoper/Opera stabile
Hebebühne
Hochschule für Musik und Theater
Hüter-Ensemble
Fluctoplasma
|
 |
 |
 |
 |
 |
Imperial Theater
Kammerspiele, Logensaal
Kampnagel
Kellertheater
Klabauter Theater
Kulturhaus 73
Kraftwerk Bille
Lichthof
Meyer&Kowski
Monsun Theater
MS Bleichen, MS Stubnitz
MUT-Theater
Opernloft
Operettenhaus
Ohnsorg Theater
Polittbüro
Resonanzraum
Schauspielhaus
Schauspielstudio Frese
Savoy
Das Schiff
Schmidt Theater
Schmidts Tivoli
Sommertheater St. Georg
St. Pauli Theater
|
 |
 |
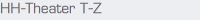 |
 |
 |
Thalia Theater
Theater Altes Heizkraftwerk
Theater Axensprung
Theater Das Zimmer
Theaterdeck
Theater im Hamburger Hafen
Theater im Zimmer
Theater in der Speicherstadt
Theater Kehrwieder
Theater N.N.
Theater Zeppelin
Tonali
University Players
Werkstatt 3
Winterhuder Fährhaus, Theater Kontraste
Die 2te Heimat
U3-Ensemble
Die Wiese
|
 |
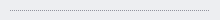 |
 |
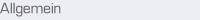 |
 |
 |
Startseite
Spiegelneuronen, Kampnagel
KEIN SCHÖNER SCHLAND, Hf MT
IM CABARET, AU CABARET, TO CABARET, HfMT
Eigengrau, Sprechwerk
Der alte Mann und ein Meer, HfMT
Zu Schad, Tonali
A PLACE CALLED HOME, Kampnagel
Ocean cage, Kampnagel
Der eigene Tod, DSH
Gesetze schreddern, Malersaal
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
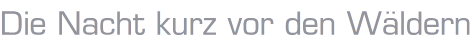 |
Die Nacht kurz vor den Wäldern |
 |
|
Immer Fremder, immer fremder
Tänzelnd erzählt der Mann, wie sich in seiner Umgebung die anderen amüsieren und das Leben genießen. Ihm gelingt das nicht. Ihm ist klar, wie wenig feiernswürdig sein Leben ist. Sein Tänzeln wird erst zu einem Stolpern dann zu einem Straucheln.
Der Namenlose und Heimatlose läuft durch die Stadt, immer auf der Suche nach etwas, an dem er wenn auch nur für ein paar Stunden festhalten kann. Mal ist eine schöne Frau, mal eine Nutte, mal ein „Kamerad, den er anhaut“. Ihm erzählt er von seiner großen Idee: Der internationalen Gewerkschaft. Doch so recht mag er selbst nicht daran glauben. Denn wo sollte er, der immer ein Fremder bleiben würde, die Kraft und Zuversicht für eine große Bewegung hernehmen?
Heiko Raulin zeigt ihn gleich zu Beginn schon mit einem Hauch Angeschlagenheit. Auch wenn er in feinem Zwirn, Hemd, Krawatte und Intellektuellen-Brille daherkommt, steht er unbeweglich da, halb in Schräglage am Bühnenrand. Nie überschreitet die beiden weißen Linien auf dem Boden, die ihm seinen festgesetzten Platz in dieser Gesellschaft zuweisen. Starr starrt er auf die flackernde Neonröhre, die in unregelmäßigem Rhythmus ihr Licht ändert. Unter ihr ist im Halbdunkel eine Lache zu erkennen. Wie sich später rausstellen wird: eine Blutlache. Der Namenlose wird zusammengeschlagen von zwei Halbstarken. Als er am Boden liegt, spult das kleine Diktiergerät verzerrt Teile seines Berichtes ab. Die Unordnung seines Lebens, die er mühsam in Griff zu bekommen versuchte, hat die Überhand bekommen. Sie hat ihn niedergestreckt und kleingemacht. Als er sich zum Schluss noch einmal aufrappelt und den Blick hebt, ist in seinen Augen nur noch Angst zu erkennen.
Matthias Jochmann hat zusammen mit Raulin aus dem Text von Benard-Marie Koltes einen intensiv-beunruhigende konzentrierte Stunde gemacht. Die eigenwillige Lichtregie von Susanne Ostwald trägt entscheidend zur verunsichernden Stimmung bei.
Birgit Schmalmack vom 24.9.12
|
 |
 |
Zur Kritik von |
 |
|
|
 |
 |
|
Druckbare Version
|
|
Der zerbrochene Krug
Jeder stirbt für sich allein
|
|
 |
|