 |
 |
 |
 |
 |
 |
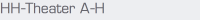 |
 |
 |
Allee Theater/Theater für Kinder
Alma Hoppe
Altes Heizkraftwerk
Altonale
Altonaer Theater
Die Burg
Elfen im Park
Elbphilharmonie
Engelbach&Weinand
Engelsaal
English Theatre
Ernst Deutsch Theater
Fabrik
Feine Künste
Fleetstreet
First Stage
Gilla Cremer Unikate
Hamburger Puppentheater
Hamburger Sprechwerk
Hamburgische Staatsoper/Opera stabile
Hebebühne
Hochschule für Musik und Theater
Hüter-Ensemble
Fluctoplasma
|
 |
 |
 |
 |
 |
Imperial Theater
Kammerspiele, Logensaal
Kampnagel
Kellertheater
Klabauter Theater
Kulturhaus 73
Kraftwerk Bille
Lichthof
Meyer&Kowski
Monsun Theater
MS Bleichen, MS Stubnitz
MUT-Theater
Opernloft
Operettenhaus
Ohnsorg Theater
Polittbüro
Resonanzraum
Schauspielhaus
Schauspielstudio Frese
Savoy
Das Schiff
Schmidt Theater
Schmidts Tivoli
Sommertheater St. Georg
St. Pauli Theater
|
 |
 |
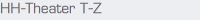 |
 |
 |
Thalia Theater
Theater Altes Heizkraftwerk
Theater Axensprung
Theater Das Zimmer
Theaterdeck
Theater im Hamburger Hafen
Theater im Zimmer
Theater in der Speicherstadt
Theater Kehrwieder
Theater N.N.
Theater Zeppelin
Tonali
University Players
Werkstatt 3
Winterhuder Fährhaus, Theater Kontraste
Die 2te Heimat
U3-Ensemble
Die Wiese
|
 |
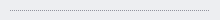 |
 |
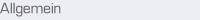 |
 |
 |
Startseite
Spiegelneuronen, Kampnagel
KEIN SCHÖNER SCHLAND, Hf MT
IM CABARET, AU CABARET, TO CABARET, HfMT
Eigengrau, Sprechwerk
Der alte Mann und ein Meer, HfMT
Zu Schad, Tonali
A PLACE CALLED HOME, Kampnagel
Ocean cage, Kampnagel
Der eigene Tod, DSH
Gesetze schreddern, Malersaal
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Das Leben ist wie eine Giraffe, die nicht aussieht |
 |
|
Sie solle einmal ihren „USP“ ausnutzen und über „ihre Leute“ in Ostdeutschland berichten. Das hört die junge Volontärin Edi (Toini Ruhnke) aus ihrer Redaktion. Doch was und wer sollen das sein? Ihr Unic Selling Point soll ihr aufgrund ihrer Herkunft den Zugang zu den unbekannten Russlanddeutschen ermöglichen. Wieder zurück nach Jena und ihre Familie für ihre beruflichen Ziele ausnutzen? Never. Genau davor ist sie doch nach Berlin gegangen. In die Stadt, in der alle Richtungen erlaubt sind. Egal ob es diese sind, aus denen man kommt oder in die man geht. Doch woher kommt sie eigentlich? Weder ihre Tante noch ihre Mutter will etwas mit der Vergangenheit zu tun haben. Sie stelle die verkehrten Fragen. Welche die richtigen sein sollen, diese Antwort bleiben sie ihr schuldig. Was interessieren Pionierlieder, Sommerlager und sowjetische Parolen heute noch? Jeder wollte nur der Fleischwolfzeit der Nachwendejahre entkommen, doch wo sind sie gelandet? In einer Plattenbausiedlung in Ostdeutschland. Einzig ihr Großvater (Stefan Stern), der aus dem umkämpften Dombass von ihrer Mutter kürzlich auch nach Jena bugsiert worden ist, hätte noch Lust über diese alten Geschichten zu sprechen. Zum 50. Geburtstag ihrer Mutter (Oda Thormeyer) lässt sich Edi jedoch überreden nach Jena zu fahren, zusammen mit ihrer Tante (Oana Solomon). Wider Willen wird diese Autofahrt zu einer Spurensuche.
Regisseur Hakan Savaş Mican hat diese Reise in die Wurzeln der eigenen Identität unaufdringlich, fast beiläufig mit viel Sinn für stimmungsvolle Momente inszeniert. Mit wenigen Strichen werden die einzelnen Personen gezeichnet. Die Mutter will die Familie unbedingt zusammenhalten, spielt auch nach außen gerne die perfekte Mutter mit den perfekt geratenen Kindern, auch wenn sie dafür die Wahrheit ab und zu verbiegen muss. Eine lesbische Tochter, die nie einen Schwiegersohn mit nach Hause bringen wird und etwas auf dem Kopf hat, bei dem die anderen nur fragen, was das denn sei und Edi entgegnet: „Haare!?“, gehören definitiv nicht dazu. Die Tante ist da schon eher in der Realität verwurzelt. Ohne Mann fällt sie eh durchs Raster. Nachdem sich ihre Tochter (toll: Pauline Rénevier) in eine als Autismus diagnostizierte Soziphobie gerettet hat, um jedem familiären Kontakt aus dem Weg zu gehen, steht ihr das Glänzen vor der Community sowieso nicht mehr zur Verfügung.
Musik (live von Masha Kashyna und Stefan Stern) spielt in der Inszenierung im Thalia in der Gaußstraße eine wichtige Rolle. Denn einzig die Schnulzen auf Russisch können Edis Vorgängergeneration noch ungefilterte Emotionen entlocken. Während auf der Bühnenrückwand die Spielorte mit Videoaufnahmen bebildert werden, ergeben sich dabei so schöne Szenen wie folgende: Während der Großvater ein russisches Lied singt, sitzen die übrigen Mitspieler auf dem braunhölzernen Mobiliar, das wie für einen Umzug zusammen gestellt worden ist, und der Schnee rieselt aus der Bühnendecke. Denn wie sagte Mutter so treffend: "Was ich vermisse, das ist der Schnee." Alles andere bleibt lieber unter der verschwiegenen Oberfläche.
Edi lernt in einem Berliner Club eine Frau (Masha Kashyna) kennen, die ein ungewöhnliches Tattoo hat. Eine Giraffe, die aber nicht aussieht wie eine Giraffe. Sie sei eben, wie sie ist. So bastelt Edi aus ihrem abgelehnten Artikel eine Papiergiraffe, die auch nur ungefähr so aussieht wie eine Giraffe. Das wird zum Motto des Inszenierung von Sasha Marianna Salzmanns Roman „Im Menschen muss alles herrlich“ sein. Es ist eben alles so, wie es ist. Es passt manches nicht zusammen, ergibt keinen stringenten Faden, aber so ist das Leben eben. Das Leben ist wie eine Giraffe, die nicht aussieht wie eine Giraffe. Eine Aufführung, die man sich nicht entgehen lassen sollte, um sich dann aber unbedingt das Buch zu besorgen.
Birgit Schmalmack vom 2.1.23
|
 |

Im Menschen muss alles herrlich sein, Thalia © Krafft Angerer
|
|
Druckbare Version
|
|
Die Rache der Fledermaus, Thalia
Ödipus Tyrann, Thalia
|
|
 |
|