 |
 |
 |
 |
 |
 |
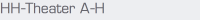 |
 |
 |
Allee Theater/Theater für Kinder
Alma Hoppe
Altes Heizkraftwerk
Altonale
Altonaer Theater
Die Burg
Elfen im Park
Elbphilharmonie
Engelbach&Weinand
Engelsaal
English Theatre
Ernst Deutsch Theater
Fabrik
Feine Künste
Fleetstreet
First Stage
Gilla Cremer Unikate
Hamburger Puppentheater
Hamburger Sprechwerk
Hamburgische Staatsoper/Opera stabile
Hebebühne
Hochschule für Musik und Theater
Hüter-Ensemble
Fluctoplasma
|
 |
 |
 |
 |
 |
Imperial Theater
Kammerspiele, Logensaal
Kampnagel
Kellertheater
Klabauter Theater
Kulturhaus 73
Kraftwerk Bille
Lichthof
Meyer&Kowski
Monsun Theater
MS Bleichen, MS Stubnitz
MUT-Theater
Opernloft
Operettenhaus
Ohnsorg Theater
Polittbüro
Resonanzraum
Schauspielhaus
Schauspielstudio Frese
Savoy
Das Schiff
Schmidt Theater
Schmidts Tivoli
Sommertheater St. Georg
St. Pauli Theater
|
 |
 |
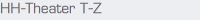 |
 |
 |
Thalia Theater
Theater Altes Heizkraftwerk
Theater Axensprung
Theater Das Zimmer
Theaterdeck
Theater im Hamburger Hafen
Theater im Zimmer
Theater in der Speicherstadt
Theater Kehrwieder
Theater N.N.
Theater Zeppelin
Tonali
University Players
Werkstatt 3
Winterhuder Fährhaus, Theater Kontraste
Die 2te Heimat
U3-Ensemble
Die Wiese
|
 |
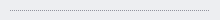 |
 |
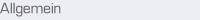 |
 |
 |
Startseite
Spiegelneuronen, Kampnagel
KEIN SCHÖNER SCHLAND, Hf MT
IM CABARET, AU CABARET, TO CABARET, HfMT
Eigengrau, Sprechwerk
Der alte Mann und ein Meer, HfMT
Zu Schad, Tonali
A PLACE CALLED HOME, Kampnagel
Ocean cage, Kampnagel
Der eigene Tod, DSH
Gesetze schreddern, Malersaal
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Die schöne neue Welt |
 |
|
Die schöne Welt klingt gut und sieht gut aus. Die junge Band (Christoph Hart, Matze Pröllochs, Julia Förster) trägt goldene barocke Kleider über ihren blauen Anzügen. Die Welt gibt sich einen glänzenden Anstrich. Der Moderator (Abdul Kader Traoré ) gibt sich schmissig launig. Doch eigentlich ist der nur der Schaffner in unserem Lebenszug, der ganz DB-like stets Verspätung hat. Gründe werden nicht genannt, aber das ist man ja gewohnt. Wenig ermutigend auch: Auf uns wird keiner warten. Denn im diesem Zug sitzen eher die Abgehängten, die Ausgestoßenen und die Verletzten. Die von den Anderen auf der Überholspur längst hinter sich gelassen worden sind. Auf den Haltestationen werden kurz ihre Geschichten angerissen, bevor der ICE wieder weiterjagt, seinem nächsten Ziel entgegen, ohne je anzukommen. Denn am Ende wird er wieder dort sein, wo er gestartet ist. Er ist im Kreis gefahren.
So stehen die beiden Kinder (Maike Knirsch, Björn Meyer ) wie am Anfang stumm vor dem Krankenzimmer ihres Vaters. "Wir trauen uns nicht hinein", geben sie endlich zu. Sie fürchten sich vor der Konfrontation mit dem Anblick, der sie erwartet. Ihr Vater hat sich nach dem Bankrott seines Autoreifenhandels mit Benzin übergossen und angezündet. Jetzt ringt er mit seinen beiden letzten Synapsen um die Fetzen seiner Erinnerungen, die er noch besitzt. Die Mutter steht derweil daneben und wiederholt mantraartig: "Es geht ihm schon besser." Obwohl sie sicher weiß, dass dies eine Lüge ist.
Dazwischen liegen viele Stationen und viele nur skizzierte Leben: Die der chinesischen Fabrikarbeiter, die sich aus Zhangzhou auf den Weg in eine sonnigeres Zukunft nach Italien machen, um dann festzustellen, dass sie wieder in einer chinesischen Fabrik gelandet sind, mit lauter chinesischen Arbeitern. Doch nur so lange, bis diese Textilfabrik in Flammen aufgeht. Sie stellen ernüchtert fest: "Die Hemden haben einen Wert, wir haben aber nicht. Wir haben keine Etikett Made in Italy."
Man hält auch in Manaus, wo das Zeitalter der Ausbeutung begann. Der Mann in Khakishorts trägt das in seiner betont launigen Diashow vor. Politisch korrekte Sprechweise benutzt er nur als dünnen Firniss über seiner unverhohlen rassistischen Sichtweise. Wenn er Jenny aus der Technik auffordert ein nächstes Bild zu zeigen, bleiben die Folien jedoch leer. Es braucht keine Bilder, um das Grauen seiner Beschreibungen zu entlarven. Einzig am Schluss seiht man vier aneinander gekettete Menschen . Ein Ritter bzw. selbsternannter Retter ist zu ihnen hinaufgeklettert und will ihnen nicht nur eine Oper sondern gleich eine bessere Welt bauen. Es ist von vornherein klar, dass er damit scheitern wird.
Eine weitere Station des ewigen ICEs ist das Hotel Palestine in Bagdad. Hier hocken auf 40 Etagen Journalisten aus aller Welt zusammen, um ihre Bilder vom Krieg in die Welt zu schicken. Dabei sind sie von dem Geschehen so weit abgeschnitten wie die Reporterin, die in einen der Bühnen-Container hoch oben schwebt, ohne jede Bodenhaftung. Sie hat den Kontakt zur realen Welt schon lange eingebüßt und soll ihn doch jeden Tag beschreiben und bebildern.
Keine dieser Episoden, keine dieser Geschichten ist neu, alle nimmt man als Zuschauer zur Kenntnis, ohne wirklich berührt zu werden. Erst die erste und letzte um den sterbenden Vater, der sich in die "selbstverschuldete Selbstständigkeit" stürzte, wie die Mutter es anklagend formuliert, gelingt das. Denn erst bei ihr wagt der Regisseur Christopher Rüpling die Schauspieler:innen in ihre Rollen schlüpfen zu lassen. Ansonsten bemüht er stets Mittel der Distanzierung, die genau dies schwierig machen. Mal lässt er den Text von Projektionen ablesen, mit dem Rücken zum Publikum, mal stellt er einen ironisch kommentierenden Chor an den Rand, mal steckt er die Figuren in weiße Ritterkostüme, die sie karikieren. Einzig die Band, die live auf der Bühne agiert, scheint ganz in sich und ihrer Musik zu ruhen. Sie ist schließlich nur für eines zuständig: Für den antreibenden Soundtrack, der den ICE weiter kreisen lässt.
Rüpling hatte ursprünglich mit dem sprachgewaltigen Text von Köck etwas ganz Anderes vor: Er wollte das komplette Thaliaareal an verschiedenen Stationen bespielen. Doch Corona machte eine Strich durch die Rechnung und ließ ihn die Inszenierung auf ein stationäres Drama zusammenkürzen. Von der Mobilität wird nun zwei Container übrig geblieben, die ohne große Motivation mal von der einen Seite auf die andere , mal übereinander, mal nebeneinander geschoben oder gehoben werden. Das wäre zu verschmerzen, aber die Distanzierung zu den Personen auf der Bühne lässt den Abend ohne große Emotionen vorbeiziehen.
Doch diese ernüchternde Erkenntnis, die uns Rüpling mit seiner Arbeit eventuell vermitteln wollte, bleibt leider auf der intellektuelle Ebene stecken. Sie in ihrer ganzen emotionalen Wucht zu spüren zu lassen, hätte aus dem Abend auch in dieser verkleinerten Form etwas Großes werden lassen.
Birgit Schmalmack vom 18.3.22
|
 |
 |
|
Druckbare Version
|
|
Onkel Wanja, Thalia
Eurotrash, Thalia
|
|
 |
|