 |
 |
 |
 |
 |
 |
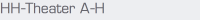 |
 |
 |
Allee Theater/Theater für Kinder
Alma Hoppe
Altes Heizkraftwerk
Altonale
Altonaer Theater
Die Burg
Elfen im Park
Elbphilharmonie
Engelbach&Weinand
Engelsaal
English Theatre
Ernst Deutsch Theater
Fabrik
Feine Künste
Fleetstreet
First Stage
Gilla Cremer Unikate
Hamburger Puppentheater
Hamburger Sprechwerk
Hamburgische Staatsoper/Opera stabile
Hebebühne
Hochschule für Musik und Theater
Hüter-Ensemble
Fluctoplasma
|
 |
 |
 |
 |
 |
Imperial Theater
Kammerspiele, Logensaal
Kampnagel
Kellertheater
Klabauter Theater
Kulturhaus 73
Kraftwerk Bille
Lichthof
Meyer&Kowski
Monsun Theater
MS Bleichen, MS Stubnitz
MUT-Theater
Opernloft
Operettenhaus
Ohnsorg Theater
Polittbüro
Resonanzraum
Schauspielhaus
Schauspielstudio Frese
Savoy
Das Schiff
Schmidt Theater
Schmidts Tivoli
Sommertheater St. Georg
St. Pauli Theater
|
 |
 |
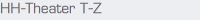 |
 |
 |
Thalia Theater
Theater Altes Heizkraftwerk
Theater Axensprung
Theater Das Zimmer
Theaterdeck
Theater im Hamburger Hafen
Theater im Zimmer
Theater in der Speicherstadt
Theater Kehrwieder
Theater N.N.
Theater Zeppelin
Tonali
University Players
Werkstatt 3
Winterhuder Fährhaus, Theater Kontraste
Die 2te Heimat
U3-Ensemble
Die Wiese
|
 |
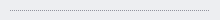 |
 |
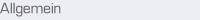 |
 |
 |
Startseite
Spiegelneuronen, Kampnagel
KEIN SCHÖNER SCHLAND, Hf MT
IM CABARET, AU CABARET, TO CABARET, HfMT
Eigengrau, Sprechwerk
Der alte Mann und ein Meer, HfMT
Zu Schad, Tonali
A PLACE CALLED HOME, Kampnagel
Ocean cage, Kampnagel
Der eigene Tod, DSH
Gesetze schreddern, Malersaal
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Front, Thalia |
 |
|
Im Stahlplattengewitter
Ein kreischender Fanfarenstoß markiert den Beginn. Der Klangkünstler Ferdinand Försch erzeugt die drohenden Stahlgewitter mit den Blechplatten, die die ganze Rückwand bedecken. Die Front ist ein Käfig. In ihm verliert man entweder den Verstand oder die Gefühle.
In schwarzen Anzügen wie zu einer Beerdigung sind die neun Männer und zwei die Frauen erschienen. Es wird ihre eigene und die einer zivilisierten Gesellschaft sein. Sie stehen alle an der Front, aber auf verschiedenen Seiten. Auf der Bühne des Thalia Theaters sitzen Belgier, Franzosen, Engländer und Deutsche einträchtig nebeneinander. Hier sprechen sie und nicht ihre Befehlshaber. Aus ihren Zeugnissen, die Erich-Maria Remarque in „Im Westen nichts Neues“ und Henri Barbusse in „Tagebuch einer Korporalschaft: Le Feu“ eingefangen haben, und Feldpostbriefen ist dieser Erinnerungsabend an den 1. Weltkrieg entstanden. Es gibt hier keine Gewinner nur Verlierer. Für jeden Meter gewonnenen Bodens muss mindestens ein Soldat auf beiden Seiten sein Leben lassen. Hier werden die Menschen zum Material. Selbst die sterbenden Pferde bekommen mehr Mitleid als die sterbenden Soldaten.
Die Männer sind zu aufgerissenen Fleischmassen geworden. Froh muss schon derjenige sein, dem nur ein Bein abhandenkommt. Die Krankenschwester darf hier keine Frau mehr sein, denn sie begegnet keinen Männern mehr. Da wimmern die Männer „Sister“, alle erwarten von der Schwester Hilfe, wenn auch nur zum Sterben. Denn hier geht es selten um Gesundung sondern um einen schnelleren Tod.
Der Bestialität des Krieges kommt Luk Perceval in seiner kongenialen Aufführung mit schlichten Worten, einfachen Bildern und starken Klängen ganz nah. Dort wo die Worte versagen, lässt er das Schweigen sprechen. Zum Schluss schließen die Männer auf der Bühne einfach ihre Augen und eine Frau knipst ihnen ihr Bühnen (Lebens-) Licht aus. So einfach kann eindrucksvolles und engagiertes Theater sein.
Birgit Schmalmack vom 1.5.14
|
 |
 |
|
Druckbare Version
|
|
Die Möwe
Das Ende einer Liebe
|
|
 |
|