 |
 |
 |
 |
 |
 |
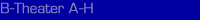 |
 |
 |
Ackerstadtpalast
Acud-Theater
AHA
Alte Münze
Anu Theater
aufbruch Gefängnistheater
Ballhaus Naunynstraße
Ballhaus Ost
Berghain
Berliner Ensemble
BKA
Brotfabrik
Circus Festival Berlin
Deutsche Oper Berlin
Deutsches Theater
English Theatre
Garntheater
Globe Berlin
Gorki
HAU
Haus der Statistik
Heimathafen
Haus der Berliner Festspiele
|
 |
 |
 |
 |
 |
Kindl Zentrum
Komödie am Kürfürstendamm, Schillertheater
Komische Oper
Monbijoutheater
Neuköllner Oper
Radialsystem
Ratibortheater
Ringtheater
Schaubühne
Schaubude
Shakespeare Company Berlin
Sophiensäe
Schlossparktheater
|
 |
 |
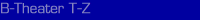 |
 |
 |
TAK
Theater am Kürfürstendamm im Schillertheater
Theater Delphi
Theaterdiscounter
Theater Strahl
Theater unterm Dach
Toula Limnaios
Uferstudios
Verlängertes Wohnzimmer
Vierte Welt
Volksbühne
|
 |
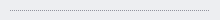 |
 |
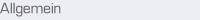 |
 |
 |
Startseite
Steife Brise vs. Poetry Slam, Centralkomitee
Kleiner Mann, was nun?, Ohnsorg
St Pauli Theater meets Elphilharmonie 2025
Der Zusammenstoß, Malersaal
Dat Frollein Wunder, Ohnsorg
Die Maschine, DSH
Jekyll und Hyde, Imperial Theater
Der Nussknacker und mehr, Kulturkirche Altona
JEEVES & WOOSTER, English Theatre
Alles was wir nicht erinnern, Thalia
Der Kuss, Sprechwerk
Winterreise, Lichthof
Bernarda Albas Haus, Schauspielhaus
Slow burn, Hamburg Ballett
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
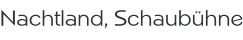 |
Streit ums Erbe |
 |
|
Das kommt in den besten Familien vor. Der Vater ist tot, die Geschwister treffen sich um das Haus aufzulösen und der Streit ums Erbe beginnt. Das geht schon mit der richtigen Wortwahl für die Situation los: hat der Sohn (Moritz Gottwald) das Recht, Gefühle für seinen Vater zu empfinden, jetzt wo es ihm keine Verpflichtung mehr kostet. Die windeln hat nämlich die Tochter (Genija Rykova) gewechselt, die ihn bis zum Schluss gepflegt hat und nun den Erstanspruch auf ihren Vater anmeldet. Zum Glück scheint da zunächst nicht viel zu verteilen zu sein. Lauter Müll und Schrott. Doch dann entdeckt man auf dem Dachboden ein Bild, noch in Packpapier verpackt. Ein naturalistisches kitschiges Aquarell einer Kirche, unterzeichnet mit A. Hiller. Schnell sieht man anstatt des ersten "l" ein "t" ein. In der braunen Zottelhölle dieser Familie sitzt praktischerweise gleich eine Frau Doktor (Julia Schubert), passenderweise mit Vornamen "Eva", und kann mit profunder, durch Generationen weitergegebener Expertise das gewünschte Gutachten herstellen, das einen potenziellen Käufer (Damir Avdic) ins Haus bringt. Plötzlich locken das Geld, die Grundlage für ein Haus, für die Gründung einer neuen Familie, das große Geschäft. Dumm nur, dass da ein Familienmitglied so penetrant stört und nervt. Philipps Ehefrau (Jenny König) ist nicht nur Vegetarierin sondern auch Jüdin und nimmt dieses vermeintliche Hitlerbild-Erbe allzu persönlich, wie der Familienrat schnell beschließt. Sie redet von Schuld, Täterkult, Rassismus und Nazierbe. Das stört beim Geschäftemachen.
Marius von Mayenburg lässt in seiner Komödie über den politisch korrekten Umgang mit dem Erbe der deutsch-jüdischen Vergangenheit keinen Fettnapf aus, ganz im Gegenteil, er nimmt Anlauf, springt in jeden hinein und suhlt sich mit Lust in diesem braunen Unrat, der wie die Fusseln des Teppichs an dieser Familie klebt. Wenn er dann als Regisseur seines eigenen Textes auch noch süßlichen Heimat-Liedkitsch wie den dunkelbraunen klebrigen Pflaumenmus aus den Einweckgläsern des Vaters über diese nette deutsche Familie kippt, wird es nur umso unappetitlicher. Die Botschaft ist klar, und zwar überdeutlich. Doch wo ein feines Gespür für zartere Untertöne noch effektvoller gewesen wäre, haut er lieber im wahrsten Sinne auf die K.... Dabei zeugen die intellektuellen Wortgefechte über weite Strecken von Sprachvermögen auf höchsten Niveau und von der großen Lust an dialektischen Diskursen, die durchaus den Kern der deutschen Seele zu treffen vermögen. Die Überdrehung ins Klamaukige schmälert diese Vergnügen aber eher, als das es es unterstützt.
Birgit Schmalmack vom 20.10.23
|
 |

Nachtland, Schaubühne © Gianmarco Bresadola
|
|
Druckbare Version
|
|
Im Herzen der Gewalt, Schaubühne
|
|
 |
|