 |
 |
 |
 |
 |
 |
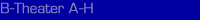 |
 |
 |
Ackerstadtpalast
Acud-Theater
AHA
Alte Münze
Anu Theater
aufbruch Gefängnistheater
Ballhaus Naunynstraße
Ballhaus Ost
Berghain
Berliner Ensemble
BKA
Brotfabrik
Circus Festival Berlin
Deutsche Oper Berlin
Deutsches Theater
English Theatre
Garntheater
Globe Berlin
Gorki
HAU
Haus der Statistik
Heimathafen
Haus der Berliner Festspiele
|
 |
 |
 |
 |
 |
Kindl Zentrum
Komödie am Kürfürstendamm, Schillertheater
Komische Oper
Monbijoutheater
Neuköllner Oper
Radialsystem
Ratibortheater
Ringtheater
Schaubühne
Schaubude
Shakespeare Company Berlin
Sophiensäe
Schlossparktheater
|
 |
 |
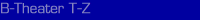 |
 |
 |
TAK
Theater am Kürfürstendamm im Schillertheater
Theater Delphi
Theaterdiscounter
Theater Strahl
Theater unterm Dach
Toula Limnaios
Uferstudios
Verlängertes Wohnzimmer
Vierte Welt
Volksbühne
|
 |
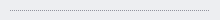 |
 |
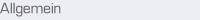 |
 |
 |
Startseite
Bernarda Albas Haus, Schauspielhaus
Slow burn, Hamburg Ballett
Finale Furioso, Monsun
Spiegelneuronen, Kampnagel
KEIN SCHÖNER SCHLAND, Hf MT
IM CABARET, AU CABARET, TO CABARET, HfMT
Eigengrau, Sprechwerk
Der alte Mann und ein Meer, HfMT
Zu Schad, Tonali
A PLACE CALLED HOME, Kampnagel
Ocean cage, Kampnagel
Der eigene Tod, DSH
Gesetze schreddern, Malersaal
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Jeder Mensch ist eine Insel |
 |
|
"Ich fürchte mich vor dem Tod", bekennt der junge Mann auf der Bühne. Doch die Fünf, die da auf der Bühne stehen, haben Angst vor dem Leben. Sie fürchten sich davor, den falschen Weg zu wählen aus den vielen Möglichkeiten die ihnen vermeintlich offen stehen. Wie angesichts des ganzen Chaos, über das sie sich so ausgiebig umfassend informieren können, nicht den Mut verlieren. So viele mögliche Aufgaben, die auf sie warten. Sie sind die Generation, die das Ruder noch einmal herumreißen können. Die vielleicht die kommenden Katastrophe noch abwenden könne. Wie könnten sie sich anmaßen die richtigen Lösungen zu finden? Wissen sie nicht eigentlich nur, dass sie immer zu wenig wissen? Sind sie nicht so ausreichend gebildet, um zu ahnen, dass sie für übergroßen Problemlagen der gesamten Welt keine Ideale mehr anzubieten haben? Wo frühere Generationen noch von Utopien träumen konnten, bleiben ihnen nur die Scherben all dieser zerbrochenen Ideale. Sind sie nicht viel zu unfertig, zu klein, zu unbedeutend, um zu handeln? Also lieber zaudern, hadern, bedenken, verwerfen. Doch nicht mit dem Gegenüber, nein, sie sind zu sehr mit der Selbstfindung beschäftigt. Erst danach kann wohlmöglich ein gemeinsamer Weg beschritten werden. So drehen sie sich um sich selbst, sind unfähig zur Kommunikation und sind doch so alleine,. Hört hier jemand zu? Versteht hier jemand den anderen?
Jeder Mensch ist eine Insel. Jeder Mensch ist ein um sich selbst kreisender Stern. Immer Angst vor dem Verglühen. Werde ich etwas Sichtbares bewirken können? Wenn ich meine Füße in die kleine Wasserschüssel gestellt habe, kann ich kurzfristig der Illusion hinterher hängen, dass ich Spuren hinterlasse. Doch kaum sind sie getrocknet, werden auch sie verschwunden sein. Die Gedankenfäden auf der Bühne werden gesponnen, wie die Wollfäden, die die Fünf über die Bühne ziehen und in denen sie sich nur verheddern.
Mal scheint ein kleiner Hoffnungsschimmer gefunden, doch im nächsten Satz fällt ein Verhinderungsgrund schon dem eigenen Gedanken in die Quere. Bloß nicht handeln müssen. Und doch gleichzeitig ständig ein schlechtes Gewissen deswegen haben. Darin sind zumindest die drei Dauerbedenkenträger (Jonathan Bamberg, Magdalena Scharler statt der erkrankten Katharina Rosenberger, Mira Sharma) gefangen. Die zwei anderen (Alaa Nasser, Mohammed Ali) bleiben dagegen merkwürdig still. Nur wenige Sätze tragen sie dazu bei. Wenn sie den Mund aufmachen, dann auf weniger hohen Erregungslevel. Nasser verrät einmal warum. Sie habe den Zugang zu ihren Erinnerungen verloren. Sie fühle nichts mehr. Neben den drei deutschen Schauspieler*innen stehen auch zwei, die aus Syrien nach Deutschland geflohen sind, auf der Bühne.
Wenn sie angesichts des Chaos Verzweiflung empfinden, dann meinen sie eine erlebte Zerstörung und nicht eine gedachte, von der die anderen Drei reden. So ist jeder der Fünf gefangen in seiner eigenen Trauer, seiner Angst und seiner Einsamkeit. Keiner kann dem anderen helfen, keiner kann den anderen verstehen, keiner kann den anderen wärmen.
Darin liegt die eigentliche Utopielosigkeit, die die jungen Leute hier verhandeln. Die fehlende Verständigung, fehlende Gemeinsamkeit, fehlende Gemeinschaft. Angesichts der Coronakrise bekommt dieses tiefgründige Stück eine noch viel stärkere Wucht, als das Team von syn:fomrat im August 2019 ahnen konnte. Dank der hervorragenden Schauspieler wurde die anspruchsvolle Textgrundlage aus Monologen zu einer scharfen, eindringlichen Analyse der verzweifelten Gemütslage einer Generation, der einerseits alle Wege offen zu stehen scheinen und die sich andererseits mit dem möglichen baldigen Ende der bisher bekannten Welt konfrontiert sieht. Der nachgesagt wird, dass sie nur dem eigenen Vergnügen nachjage und die damit vielleicht nur ihre dringend benötigte Auszeit von ihrer erdrückenden Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit offenbart.
Doch zum Schluss wagt eine von ihnen einen kleinen hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft: Vielleicht werden sie die Generation gewesen sein, von der man sagen werde, dass sie begonnen hätten eine Zukunft zu bauen. Noch alles vorsichtig im Konjunktiv. Aber damit entlässt der Abend seine Zuschauer*innen aus dem Theater im Delphi in die Herbstnacht.
Birgit Schmalmack vom 19.10.20
|
 |

Alles was wir haben syn:format
|
Interview mit Magdalena Scharler |
 |
|
Von der Notwendigkeit zu spielen
Eigentlich sollte sie nur eine Lücke füllen. Dem Abschlussjahrgang des Michael Tschechow Studios Berlin fehlte noch das geeignete Projekt, das stets am Ende des Studiums präsentiert wird. Da fragte man bei der jungen, neuen Dozentin Magdalena Sch, ob sie nicht eine Stückentwicklung machen könnte, und zwar mit den Abschlussstudent*innen und einem Teil ihres syrischen Ensembles syn:format. Interessant, dachte sich Magdalena Scharler
Doch würde das auch mit zwei Muttersprachen klappen? Doch im geschützten Raum der Schauspielschule hatte sie große Lust das auszuprobieren.
Scharler schätzt bei ihrer Arbeit der Stückentwicklung mit syn:format, gerade, dass deren Texte von extrem hoher poetischer und emotionaler Intensität seien, die sich Deutsche häufig nicht mehr trauen würden. In der Begegnung mit den deutschen, eher analytischen und reflektierenden Ansätzen könnte es so zu einer interkulturellen bereichernden Zusammenarbeit für beide Seiten kommen. Lange sei die Zusammenarbeit aber schwierig gewesen. Denn es gibt viele kulturelle Unterschiede. "Wir suchen das Gemeinsame um das Trennende auszuhalten." Schließlich hätte genau diese Haltung geholfen, sich jetzt wie ein Ensemble zu fühlen.
Das Ergebnis von „Alles was wir haben“ bei der ersten Aufführung in der Schauspielschule überraschte sie total: „Huch, was haben wir denn da geschaffen?“ Es war ein Werk geworden, mit dem man raus gehen musste. So kam es im Herbst 2019 schon in Sachsen Anhalt zur Wiederaufnahme und jetzt nach dem Shutdown zu weiteren im Berliner Theater im Delphi.
Hier war nun zu erleben, wie fünf junge Menschen auf der Bühne um die Themen Einsamkeit, Verantwortung, Lähmung und Zukunftsangst ringen. Und zwar fast durchgehend in um sich selbst kreisenden, selbst verfassten Monologen. Scharlers Vater ist Dirigent. "Er hat mir immer gesagt, du musst es machen wie bei einem Streichorchester, versuche auf alle deine Spieler*innen gleichzeitig zu hören.“ Die Schauspielmethode Michael Tschechows hilft ihr dabei. Bei ihr geht es immer darum, auf der Bühne durchgehend eine Atmosphäre zu erzeugen, die alle gleichzeitig präsent wirken lässt.
„Ich versuche meine Spieler*innen stets den Punkt zu führen, an dem ihre Notwenigkeit zu spüren ist, aus der sie heraus spielen müssen.“ Weil ihr das gelungen ist, schaffen es die Darsteller*innen in ihrem Spiel eine Dringlichkeit zu erzeugen, die den Abend trägt und die Zuschauer*innen nicht ungerührt lässt.
Birgit Schmalmack vom 22.10.20
|
 |
 |
|
Druckbare Version
|
|
Theater Delphi
|
|
 |
|